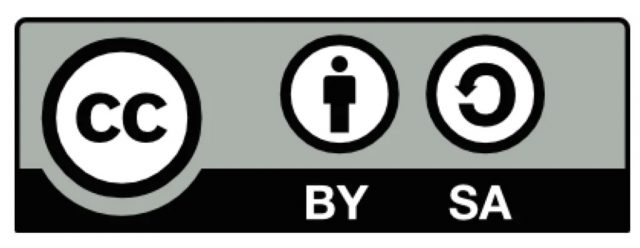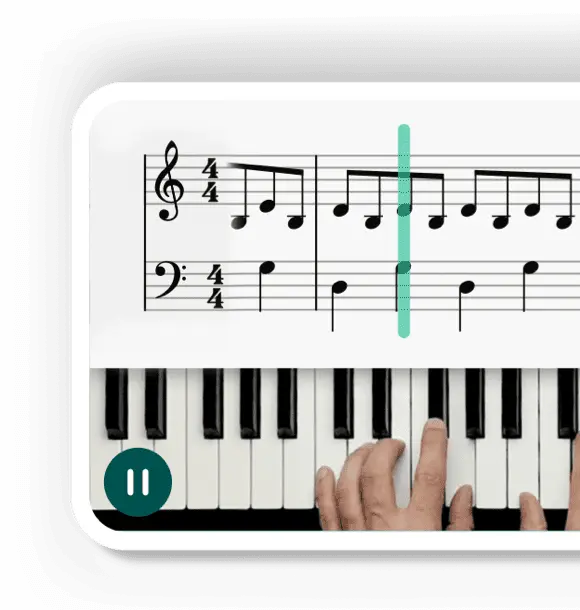Musikpräferenzen sind oft tief in der nationalen Kultur verwurzelt und spiegeln die lokale Identität wider. Der Erfolg heimischer Künstler stärkt nicht selten den regionalen Zusammenhalt. Aktuelle Streaming-Daten zeigen jedoch signifikante Unterschiede im globalen Hörverhalten: Während beispielsweise in Indien fast ausschließlich lokales Repertoire konsumiert wird, dominieren in vielen anderen Ländern internationale Hits die Charts. Dies wirft die Frage auf, warum die Balance zwischen nationalen Inhalten und globalen Trends je nach Markt so unterschiedlich ausfällt.
Um dies zu untersuchen, hat die Klavierlern-App Skoove gemeinsam mit DataPulse Research die wöchentlichen Spotify Top 200-Charts analysiert. Die Daten wurden über 59 Wochen in 73 Ländern erhoben. Die Ergebnisse zeigen, in welchem Maße heimische Talente die Top 200-Listen dominieren oder ob internationale Performer den jeweiligen Markt anführen. Hier finden Sie zunächst den globalen Überblick. Vertiefende Analysen für Deutschland, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Japan und Südkorea haben wir ebenfalls für Sie aufbereitet.
Schlüsselerkenntnisse: Eine durch Musik geteilte Welt
- Geringer Anteil lokaler Musik: In 36 von 73 untersuchten Ländern machen lokale Künstler und Künstlerinnen weniger als 30% der nationalen Chartbekanntheit aus. Die meisten dieser Nationen streamen mehr Musik aus einem einzigen fremden Land als von all ihren heimischen Musikschaffenden zusammen. Das betrifft fast die Hälfte aller analysierten Länder und deutet auf eine weitreichende kulturelle Dominanz durch globale Streaming-Angebote hin.
- Ausnahme Costa Rica: Costa Rica ist das einzige Land der Studie, in dem kein einziger lokaler Act in den Top 200 vertreten ist. Die Charts werden stattdessen von Importen aus Puerto Rico (33%) und Kolumbien (28%) dominiert.
- Faktor Sprache: Länder mit Sprachen, die global weniger verbreitet sind, weisen eine stärkere Dominanz lokaler Musik auf. In sprachlich „isolierten“ Märkten wie Finnland, Vietnam und Italien füllen lokale Musikschaffende 70–85% der Charts. Umgekehrt haben es englischsprachige Länder schwer: Irische Acts machen nur 9% der Top 200 in ihrem Heimatland aus, in Neuseeland liegt der Anteil bei lediglich 1%.
- Phänomen Puerto Rico: Puertoricanische Musikschaffende erzielen trotz der geringen Bevölkerungszahl der Insel (3,2 Millionen) eine außergewöhnliche Reichweite in Lateinamerika. Sie erreichen 38% der Charts in El Salvador, 35% in Honduras und 30% in Spanien und übertreffen damit sogar Panama, das als Geburtsort des Reggaeton gilt.
- Globale Vereinheitlichung: Die globalen Charts werden zunehmend homogener. Dieselben 20 Acts, von Billie Eilish bis Bruno Mars, dominieren die Märkte und schaffen eine einheitliche „globale Playlist“. Die Musik klingt dadurch in Seoul, São Paulo oder Stockholm oft bemerkenswert ähnlich.
- US-Dominanz: Amerikanische Musik erreicht nahezu jeden Winkel der Welt und erscheint in 70 von 73 Ländern in den Top 5. Gleichzeitig halten US-Acts 79% ihres Heimatmarktes, eine seltene Kombination aus globaler Reichweite und lokaler Dominanz.
- Kulturelle Umkehrungen: Die Daten offenbaren überraschende Verhältnisse, die gängige Annahmen widerlegen: Das Vereinigte Königreich streamt mehr amerikanische (55%) als britische (29%) Musik in den Top 200. Pakistan konsumiert trotz politischer Spannungen mehr indische (55%) als pakistanische (26%) Musik in den Charts. Portugal importiert die Top 200 mehr aus Brasilien (31%) als es eigene Musikschaffende (20%) darin unterbringen kann.
Das globale Musik-Ökosystem: Exportnationen, Importmärkte und nationale Dominanz
Die Streaming-Daten zeigen, dass Länder im globalen Musikkonsum deutlich unterschiedliche Rollen einnehmen. Je nach Markt variiert das Verhältnis zwischen importierten Inhalten und lokaler Musikproduktion drastisch. Die folgende Aufschlüsselung visualisiert diese Dynamik und zeigt, wer wem zuhört:
Die Analyse von 73 Ländern zeigt drei unterschiedliche Musikökosysteme, die sich durch den jeweiligen Anteil lokaler Musik unterscheiden:
Die Musikexporteure: Globale Kraftpakete
Eine Handvoll Länder dominiert globale Playlists weit über ihre Grenzen hinaus. Die Vereinigten Staaten führen diesen exklusiven Club an; amerikanische Künstler beherrschen 20–50 % der Streaming-Charts in Dutzenden von Ländern. Aber die USA sind nicht allein: Südkorea exportiert K-Pop weltweit, Puerto Rico dominiert Lateinamerika mit Reggaeton, und das Vereinigte Königreich schlägt in den englischsprachigen Märkten immer noch über seine Gewichtsklasse hinaus. Diese Nationen machen nicht nur Musik; sie formen den globalen Geschmack.
- Vereinigte Staaten: Der unangefochtene König der Musikexporte. Die USA erscheinen in 70 von 73 Ländern unter den Top-5-Musikquellen. Amerikanische Künstler beanspruchen 76 % des kanadischen Chart-Erfolgs, 69 % der australischen, 69 % der neuseeländischen und sogar 55 % der britischen Charts.
- Puerto Rico: Puertoricanische Musikschaffende beanspruchen 38% von El Salvadors Charts, 38% von Venezuelas, 35% von Honduras‘, 33% von Costa Ricas und sogar 30% von Spaniens, und dominieren beide Seiten des Atlantiks durch Reggaeton.
- Südkorea: Die strategische globale Expansion des K-Pop spiegelt sich in den Zahlen wider. Koreanische Künstler beherrschen 36 % der Streaming-Charts in Taiwan und 29 % in Hongkong; sie erscheinen weltweit in 20 Ländern in den Top 5. Dies positioniert K-Pop als zweiterfolgreichsten nicht-englischen Musikexport nach dem lateinamerikanischen Reggaeton.
- Vereinigtes Königreich: Das Vereinigte Königreich erscheint in den Top 5 für 41 Länder. Britische Acts erobern 16% von Neuseelands Top 200 Charts, 15% von Australiens und 24% von Irlands. Doch paradoxerweise gibt das Vereinigte Königreich selbst mehr Chart-Präsenz an amerikanische (55%) als britische Musik (29%).
- Kolumbien: Kolumbianische Musikschaffende dominieren in ganz Lateinamerika und beanspruchen 29% von Ecuadors Charts, 28% von Costa Ricas, 25% von Perus und 26% von Venezuelas. Karol G, Maluma und Feid haben Kolumbien zur zweitgrößten Kraft in der lateinamerikanischen Musik nach Puerto Rico gemacht.
Überraschende kulturelle Abhängigkeiten
Jenseits der offensichtlichen Importeure enthüllen unsere Daten unerwartete kulturelle Abhängigkeiten, die nationale Stereotypen ausbremsen:
- Vereinigtes Königreich (29% lokal): Der Geburtsort der Beatles und Rolling Stones streamt jetzt 55% amerikanische Musik von ihren Top 200, fast doppelt so viel wie seine eigene. Trotz seines massiven kulturellen Erbes ist das Vereinigte Königreich zu einem Nettoimporteur von Musik geworden.
- Pakistan (26% lokal): In einer bemerkenswerten Umkehr politischer Spannungen streamt Pakistan mehr indische Musik (55%) als pakistanische unter den Charts. Bollywoods Soft Power überwindet Grenzen und Konflikte.
- Irland (9% lokal): Das Land von U2 und traditionellem Folk gibt 57% der Chart-Punkte an amerikanische Musikschaffende. Irische Acts erobern weniger als 9% ihrer eigenen nationalen Charts.
- Portugal (20% lokal): Die ehemalige Kolonialmacht Portugal bezieht jetzt 31% seiner Chart-Musik aus Brasilien. Seine ehemalige Kolonie beherrscht 50% mehr Präsenz als lokale portugiesische Musikschaffende.
- Taiwan (21% lokal): In Taiwan zeigt sich die deutliche Dominanz von K-Pop. Südkoreanische Musik erreicht dort einen Chartanteil von 36 % und übertrifft damit sogar den Anteil heimischer Künstler.
- Spanien (28% lokal): Überraschenderweise übertreffen puertoricanische Künstler (30 %) die spanischen Musiker in Spanien selbst. Rechnet man kolumbianische Interpreten hinzu (weitere 14 %), wird Spanien eher zum Importeur lateinamerikanischer Musik als zu einem Markt, der von heimischen Talenten dominiert wird.
- Norwegen (34% lokal): Die USA beherrschen 35% der norwegischen Top 200 Charts, mehr als norwegische Musikschaffende selbst. Ein seltener Fall eines wohlhabenden nordischen Landes, das ausländische Musik bevorzugt.
- Neuseeland (1% lokal): Ein Extremfall im anglophonen Raum, dominiert von US-Musik (69 %) und britischen Acts (16 %). Heimische Kiwi-Künstler sind im eigenen Land mit knapp über 1 % kaum messbar.
Warum lieben (oder ignorieren) Länder ihre lokale Musik?
Was erklärt die enormen Unterschiede im Streaming-Verhalten der 73 untersuchten Länder? Während Indien beispielsweise zu 85 % lokale Musik hört, sind es in Österreich nur 2 %.
Die Ursachen sind vielschichtig und hängen miteinander zusammen, doch die Sprache ist ein zentraler Faktor für die Erklärung.
Es gibt eine moderate negative Korrelation (r=–0,52) zwischen der globalen Verbreitung einer Sprache und lokalem Musik-Streaming. Wenn weniger Menschen eine Sprache global sprechen, gibt es weniger internationale Inhalte in dieser Sprache, die mit lokalen Musikschaffenden konkurrieren.
Dieses sprachliche Muster manifestiert sich in dem, was wir „Festungsmärkte“ nennen. Finnland, mit nur 5,5 Millionen Finnisch-Sprechern weltweit, erhält seine kulturelle Souveränität durch Sprachbarrieren. Indien nutzt sowohl Hindis 600+ Millionen Sprecher als auch seine vielfältigen regionalen Sprachen, um 85% lokale Dominanz zu erreichen. Währenddessen sehen sich Länder, die weit verbreitete Sprachen teilen, einer Lawine ausländischer Konkurrenz gegenüber. Irlands lokale Musikschaffende erobern nur 8% ihrer eigenen Charts und konkurrieren gegen die kombinierte Produktion der USA, des Vereinigten Königreichs, Kanadas und Australiens.
Die extremsten Fälle zeigen, wie Sprache lokale Musikszenen entweder schützen oder auflösen kann. Costa Rica steht allein mit null lokalen Musikschaffenden in seinen Charts, vollständig dominiert von spanischsprachigen Hits aus Mexiko, Kolumbien und Puerto Rico. Doch die Vereinigten Staaten und Mexiko beweisen, dass dies kein besiegeltes Schicksal ist – Marktgröße, kulturelle Identität und robuste lokale Musikinfrastruktur können sprachliche Konkurrenz überwinden.
Jenseits der Sprache: Andere Schlüsselfaktoren
Sprachliche Faktoren erklären zwar rund 27 % der Unterschiede beim Konsum lokaler Musik, jedoch spielen auch andere Aspekte eine entscheidende Rolle:
- Marktgröße zählt: Die Vereinigten Staaten trotzen dem Sprachmuster mit 79% lokaler Musik trotz 1,5 Milliarden Englischsprechern weltweit. Dank eines Binnenmarktes von 330 Millionen Menschen und einer hohen Verbreitung von Streaming kann sich die heimische Industrie auch gegen globale Konkurrenz behaupten.
- Kulturpolitik: Frankreichs 40% Radioquotengesetz, das französischsprachige Inhalte vorschreibt, korreliert mit 60% lokaler Musikschaffendepräsenz in den Charts, deutlich höher als vergleichbare europäische Märkte.
- Regionale Zentren: Puerto Rico und Kolumbien agieren als Exporteure für lateinamerikanische Musik. Ihre Dominanz in den Nachbarländern beruht auf kultureller Nähe. Auf diese Weise bilden Geografie und gemeinsame Kultur eigene Teilmärkte innerhalb desselben Sprachraums.
- Genre-Traditionen: Eine ausgeprägte lokale Musikkultur stärkt die Chartpräsenz, oft wichtiger als die Sprache selbst. So hält K-Pops einzigartiges Produktionssystem Südkorea bei 77 % lokalem Anteil in den Top 200, während die Integration von Filmmusik in Bollywood Indien 85 % sichert.
- Plattform-Demografie: Die Verbreitung von Spotify variiert je nach Land. Spricht die Plattform vorwiegend ein junges, städtisches Publikum an, dominiert internationaler Pop die Charts. Sobald Spotify jedoch die breite Masse erreicht, setzt sich der lokale Geschmack stärker durch.
Das Paradoxe an der Streaming-Ära ist: Obwohl die Plattformen Grenzen einreißen sollten, machen sie umso deutlicher, wie sehr lokale Faktoren unsere musikalische Identität formen. Was wir hören, ist keine rein persönliche Entscheidung. Es spiegelt die Sprache wider, die wir sprechen, politische Vorgaben und das kulturelle Umfeld, in dem wir uns bewegen.
Der Algorithmus-Faktor: Wie Playlists den nationalen Geschmack formen
Hinter jedem Stream liegt eine unsichtbare Kraft: der Algorithmus. Während Sprache und Kultur das Fundament für musikalische Vorlieben schaffen, agieren die Empfehlungssysteme der Streaming-Plattformen als mächtige Verstärker, die lokale musikalische Identität verstärken oder ihre Erosion beschleunigen. Aktuelle Spotify-Forschung bestätigt, dass Empfehlungen für lokale Musik „signifikant höhere Nutzerengagement-Raten“ generieren, besonders bei jüngeren Hörern.
Der Echokammer-Effekt:
Algorithmen reflektieren nicht nur kulturelle Präferenzen; sie formen sie aktiv. Wenn Nutzer in Indien, der Türkei oder Vietnam überwiegend lokale Musikschaffende streamen, lernen Empfehlungssysteme, mehr heimische Inhalte hervorzuheben, was Forscher „kulturelle Festungsmärkte“ nennen. Dieser sich selbst verstärkende Zyklus hilft zu erklären, warum diese Nationen unsere Rankings mit 85%, 83% und 83% lokalem Musikkonsum anführen. Akademische Forschung von 2024 zeigt, dass aktuelle Algorithmen oft populäre westliche Musik „überempfehlen“, aber Märkte mit starkem lokalem Hören schaffen natürlichen Widerstand gegen diese Verzerrung.
In Spotifys „Today’s Top Hits“ zu landen kann die Streams von Künstlerinnen und Künstlern erheblich steigern, aber diese redaktionellen Playlists zeigen überwiegend Musikschaffende aus dominanten Märkten. Dies schafft eine zweigeteilte Welt: In starken lokalen Märkten wie Indien oder Italien verstärken Algorithmen die heimische Dominanz; in kleineren Märkten wie Costa Rica oder Luxemburg können dieselben Algorithmen lokale Musik vollständig aus ihren eigenen Charts löschen.
Regionale Algorithmus-Dynamiken
Der Einfluss des Algorithmus variiert dramatisch je nach Region. In sprachlich unterschiedlichen Märkten wie Indien oder der Türkei neigen Empfehlungssysteme natürlich zu heimischen Inhalten. In Regionen mit gemeinsamen Sprachen sehen sich lokale Musikschaffende jedoch einer algorithmischen Lawine gegenüber. Ein irischer Musiker konkurriert nicht nur zu Hause, sondern gegen das gesamte englischsprachige Musikökosystem. Branchenanalysen betonen, dass „Lokalität formt, was wir hören“ und regionale Präferenzen auch innerhalb des globalen Streamings entscheidend bleiben.
Während Algorithmen bestehende Muster verstärken, offenbaren unsere Daten Komplexität jenseits einfacher Formeln. Die Top-5-Länder – Indien (85%), Türkei (83%), Vietnam (83%), Italien (83%) und Japan (81%) – alle erhalten außergewöhnliche lokale Musikdominanz in den Top 200 Charts trotz stark unterschiedlicher sprachlicher und geografischer Kontexte. Italiens und Japans starke Leistungen neben sprachlich isolierten Märkten wie Indien und Vietnam deuten darauf hin, dass Genre-Stärke (italienischer Hip-Hop, J-Pops Ökosystem) und kulturelle Identität genauso mächtig sein können wie Sprachbarrieren. Wie Spotifys 2024-Trendbericht bemerkt, ermöglichen Streaming-Plattformen gleichzeitig lokale Szenen und verbreiten sie global, ein Paradoxon, bei dem Algorithmen entweder Mauern bauen oder Brücken schlagen können, je nachdem, wie Hörer mit ihnen interagieren.
Und wie wir als Nächstes sehen werden: Während Algorithmen lokale Musikschaffende in Festungsmärkten schützen, schaffen sie im Rest der Welt etwas ganz anderes, eine bemerkenswert einheitliche internationale Playlist. Wenn Länder ausländische Musik streamen, ob es Indiens verbleibende 15% oder Costa Ricas komplette 100% sind, wählen sie fast genau dieselben Musiker und Musikerinnen.
Die globale Playlist: Überall dieselbe Musik
Der internationale Anteil läuft bei denselben Künstlern zusammen
Hier ist, was auffällt: Während sich Länder stark darin unterscheiden, wie viel lokale Musik sie in den Top 200 Charts streamen (von Indiens 85% bis Costa Ricas 0%), ist die internationale Musik, die sie wählen, bemerkenswert einheitlich. Eine kleine Gruppe von Musikschaffenden dominiert Charts von Seoul bis São Paulo, von Mumbai bis Montreal.
Wir haben die Spotify Top 200-Charts in 73 Ländern analysiert und die Länder in sieben globale Regionen eingeteilt. Für jeden Künstler wurde der Anteil an den Streams pro Region berechnet und anschließend ein Ranking anhand des Medianwerts der regionalen Ergebnisse erstellt. Diese Methode identifiziert jene Künstler, die die stärkste übergreifende globale Präsenz aufweisen.
Die Ergebnisse zeigen ein auffälliges Muster: Dieselbe Kerngruppe von Musikschaffenden dominiert die meisten globalen Märkte, wobei US-Pop- und Hip-Hop-Acts wie Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars und Sabrina Carpenter beispiellose Reichweite erreichen.
Diese Musiker und Musikerinnen sind teilweise erfolgreich, weil sie die von uns identifizierten Sprachbarrieren überwinden: durch englische Dominanz oder, im Fall von K-Pop, Produktionsstile, die sprachübergreifend funktionieren. Britische, kanadische und australische Musikschaffende profitieren vom gleichen englischsprachigen algorithmischen Vorteil.
Obwohl Bad Bunny weltweit die meisten Streams erzielt, schafft er es bei der globalen Konsistenz nicht unter die Top 20. Seine Dominanz in Latein- und Nordamerika erstreckt sich nicht auf Asien oder Afrika. Dies zeigt, wie Algorithmen regionale Silos schaffen, während sie gleichzeitig dieselben „globalen“ Acts überall fördern.
Ähnliches gilt für legendäre Künstler wie die Beatles oder Bob Dylan: Sie mögen einen nachhaltigen kulturellen Einfluss haben, tauchen hier aber nicht auf, weil ihnen heute die durchgängige Streaming-Präsenz in allen sieben globalen Regionen fehlt. Das „globale Monopol“ besteht in unserer Analyse nur aus Künstlern, die im Untersuchungszeitraum (2024-2025) gleichzeitig in allen Märkten – von Asien über Afrika bis Lateinamerika – in den Charts vertreten waren.
Diese Einheitlichkeit enthüllt das Paradoxon des Streamings: Algorithmen schaffen zwei verschiedene Welten. Lokale Musikschaffende gedeihen in Festungsmärkten wie Indien oder Italien, wo sie über 80% Dominanz haben. Aber dieselben globalen Hits sättigen Playlists in kleineren Märkten ohne sprachliche Barrieren oder kritische Masse vollständig. Costa Ricas Chart-Daten zeigen das Extrem. Die Algorithmen zermalmen nicht universell lokale Szenen; sie verstärken, welches Muster bereits existiert, und schaffen Winner-takes-all-Dynamiken, bei denen die Starken stärker werden und die Schwachen vollständig verschwinden.
Die Zukunft der Musik in einer geteilten Welt
Unsere Analyse enthüllt eine unerwartete Wahrheit: Plattformen, die entworfen wurden, um einen globalen Marktplatz zu schaffen, haben stattdessen lokale Präferenzen verstärkt. Indiens 85% Hingabe an heimische Musikschaffende versus Costa Ricas null repräsentiert die extremen Pole musikalischer Identität im Streaming-Zeitalter.
Die Streaming-Ära bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Während die Verbreitung noch nie einfacher war, wird der grenzüberschreitende Erfolg schwieriger. Algorithmen vergrößern die Kluft zwischen lokalen Helden und globalen Superstars.

„Das Spiel hat sich komplett verändert. Früher ging es darum, eine Fangemeinde aufzubauen, Stadt für Stadt, mit deinem Sound, der in lokalen Clubs widerhallte. Jetzt ist die Echokammer eine globale Playlist. Du versuchst nicht mehr, eine Stadt zu gewinnen; du versuchst, einem Algorithmus zu gefallen. Es ist eine fantastische Möglichkeit, die ganze Welt zu erreichen, aber man muss sich fragen, welche einzigartigen Klänge in dieser globalen Übersetzung verloren gehen.“
Für Musikschaffende könnte der Weg nach vorn nicht darin bestehen, globale Dominanz zu jagen, sondern ihre Rolle als Kulturbotschafter anzunehmen. Wie Clark beobachtet, besteht die Herausforderung nun darin, durch eine Welt zu navigieren, in der Algorithmen die Reichweite bestimmen und Playlists lokales Radio ersetzen, während die einzigartigen Klänge bewahrt werden, die die Musik jeder Kultur unterscheidbar machen.
Die Daten bestätigen, was Hörer intuitiv wissen: Menschen tendieren zu Musik, die in vertrauter Kultur und Sprache verwurzelt ist. Streaming kann Musikschaffende überall hinbringen, aber ihre Stimme muss von irgendwoher kommen.
In dieser Landschaft ist Ihr Geschmack nicht nur persönliche Vorliebe; er wird geformt von der Sprache, die Sie sprechen, den Algorithmen, die Sie bedienen, und der Kultur, die Sie bewohnen. Das Versprechen unbegrenzter Auswahl hat sich zu einer komplexen Realität entwickelt, in der Technologie und Tradition sich verflechten, um unsere Soundtracks zu schaffen.
Methodik
Die Studie wurde mit Daten der Top 200 Songs durchgeführt, die wöchentlich auf Spotify in 73 Ländern gestreamt wurden. Die Daten decken jede Woche vom 23. Mai 2024 bis zum 10. Juli 2025 ab. Die Länder befinden sich überwiegend in Europa, Amerika und Ostasien, mit einer Handvoll Ländern aus dem Nahen Osten, Subsahara-Afrika, Südasien und Zentralasien.
Wir analysierten die Chart-Performance mit einem Punktesystem: Der Song auf Platz 1 erhielt 200 Punkte, Platz 2 erhielt 199 Punkte und so weiter. Dies ermöglicht es uns, die Chart-Position angemessen zu gewichten – ein Nummer-1-Hit zählt mehr als ein Track auf Platz 200. Die in diesem Bericht gezeigten Prozentsätze repräsentieren den Anteil jedes Landes oder Musikschaffenden an den Gesamtpunkten, was effektiv ihren Anteil an der Top-200-Streaming-Aktivität gewichtet nach Chart-Position misst.
Für Songs mit mehreren Beteiligten erhielt jede beteiligte Person auf dem Track die vollen Punkte für diesen Rang. Wenn zum Beispiel ein Nummer-eins-Song drei Beteiligte zeigte, wurden jedem davon 200 Punkte zuerkannt.
Musikschaffende wurden nach ihrem Herkunftsland analysiert, nicht nach dem Standort ihres Plattenlabels, ihrer Agenten oder anderer geschäftlicher Zugehörigkeiten.
Schließlich berechneten wir für jedes Land den Prozentsatz der Chart-Positionen, die von „lokaler“ Musik (aus dem Heimatland) versus „ausländischer“ Musik (aus anderen Ländern) besetzt wurden. Durch den Vergleich dieser Zahlen konnten wir Länder nach ihrer Unterstützung für lokale Musik ranken und sehen, welche Art von Musik Menschen von außerhalb ihrer eigenen Grenzen bevorzugen.
Weltweite Chart-Dominanz-Studie
Nachdem wir die Berechnungen für jedes Land hatten, untersuchten wir einzelne Musikschaffende, um zu sehen, wer global am allgegenwärtigsten ist.
Mit demselben Rohdatensatz aggregierten wir die Länderdaten in sieben Regionen: Europa; Ostasien; Süd-, Zentral- und Westasien; Nordamerika (USA und Kanada); Süd- und Zentralamerika (einschließlich Mexiko); Ozeanien; und Afrika. Daraus berechneten wir die Chart-Präsenz jedes Musikschaffendes in jeder Region. Dies ermöglichte es uns, den Prozentsatz der Streaming-Aktivität zu sehen, den jeder Musikschaffende in den sieben verschiedenen Teilen der Welt eroberte.
Aus diesen Daten konnten wir sehen, dass einige Superstars enorm beliebt waren, aber nur in einer oder zwei Regionen. Daher bewerteten wir die Künstlerinnen und Künstler nach ihrer mittleren Punktzahl unter den sieben Regionen, um die Reichweite auf der ganzen Welt zu bewerten. Bemerkenswerterweise schaffen es riesige Musiker wie Bad Bunny (Künstler mit den meisten Chart-Punkten weltweit) nicht in die Top 25 Musik-Monokultur-Stars, weil sie nicht allgegenwärtig sind: Sie dominieren in einigen Regionen und haben nur minimale Präsenz in anderen.
Sprachkorrelationsanalyse
Um die Beziehung zwischen Sprache und lokaler Musikunterstützung zu verstehen, ordneten wir jedes Land seiner primären offiziellen oder am weitesten verbreiteten Sprache zu. Wir erhielten dann Schätzungen der globalen Sprecher für jede Sprache aus linguistischen Datenbanken. Mit der Pearson-Korrelationsanalyse berechneten wir die Beziehung zwischen der Anzahl globaler Sprecher (logarithmisch transformiert aufgrund der weiten Spanne von Millionen zu Milliarden) und dem Prozentsatz der lokalen Musikunterstützung in jedem Land.
Der resultierende Korrelationskoeffizient von -0,52 zeigt eine moderate negative Beziehung an, was bedeutet, dass Länder mit weniger globalen Sprechern ihrer Sprache dazu neigen, mehr lokale Musik zu streamen. Diese Korrelation ist statistisch signifikant (p < 0,001) und erklärt etwa 27% der Variation in lokalen Musikpräferenzen über Länder hinweg (R² = 0,27). Bemerkenswerte Ausnahmen wie die Vereinigten Staaten und Mexiko zeigen jedoch, dass Marktgröße und kulturelle Faktoren sprachliche Muster überwinden können.
Studie von: Skoove & DataPulse Research
Redaktion: Susana Pérez Posada

Mit über sieben Jahren Klavierausbildung und einer tiefen Leidenschaft für Musiktherapie bringt Susana eine einzigartige Mischung aus Expertise zu Skoove. Als Absolventin in Musiktherapie von der SRH Hochschule Heidelberg und erfahrene klassische Pianistin der Universidad EAFIT, durchdringt sie ihren Unterricht mit einem ganzheitlichen Ansatz, der traditionellen Klavierunterricht transzendiert. Susanas Schriften für Skoove kombinieren ihr reiches musikalisches Wissen mit fesselndem Geschichtenerzählen und bereichern die Lernerfahrung für Pianisten aller Stufen. Abseits des Klaviers liebt sie es, neue Orte zu erkunden und sich in ein gutes Buch zu vertiefen, da sie glaubt, dass diese vielfältigen Erfahrungen ihren kreativen Unterrichtsstil verbessern.
Diese Inhalte dürfen gerne verwendet werden
Diese Inhalte, einschließlich Bilder und Datenvisualisierungen, sind unter einer Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz lizenziert. Sie dürfen das Material teilen, kopieren, weiterverbreiten, anpassen, remixen und transformieren für jeden Zweck, auch kommerziell, solange Sie eine angemessene Namensnennung angeben. Bitte geben Sie Skoove.com als Quelle an und verlinken Sie bei der Verwendung eines Teils dieses Inhalts.